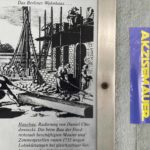//start
Berlin hat ein besonderes Verhältnis zu Mauern, speziell zu ihren Hinterlassenschaften und den Lücken, die sie gelassen haben. Im kollektiven Bewusstsein ist vor allem die Berliner Mauer, die bis 1989 auch den Doppelbezirk Friedrichshain-Kreuzberg in zwei Teile geteilt hat. Doch es gibt noch mindestens drei andere: die mittelalterliche Stadtmauer, ihre Erweiterung zur Festung im 17. Jahrhundert und eben die sogenannte Zoll- und Akzisemauer.
Die Akzisemauer war ein Ring um Berlin, der von 1734 bis 1737 errichtet und im Zeitraum zwischen 1867 und 1870 fast vollständig wieder entfernt wurde. Mehr als die Hälfte ihrer knapp 15 Kilometer verlief durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Vor allem im Osten wurde so die befestigte Stadtgrenze deutlich weiter nach außen verschoben, von der Jannowitzbrücke zur Oberbaumbrücke.
Diese Mauer diente in erster Linie dazu, den Zustrom von Waren in die Stadt zu kontrollieren, um Zölle erheben zu können. Daher auch ihr Name. Die sogenannte Akzise war die städtische Zollsteuer. Neben dieser wirtschaftlichen Funktion gab es die der Kontrolle. So konnte man sowohl den generellen Ein- und Ausgang von Menschen regulieren als auch ein Desertieren der in der Stadt untergebrachten Soldaten verhindern, die damals oft mit grausamen Maßnahmen zum Militärdienst gezwungen wurden.
Heute ist die Akzisemauer verschwunden und fast vergessen. Ihr Verlauf und die Position der einzelnen Tore aber sind in den Namen vieler U-Bahnhöfe in Friedrichshain-Kreuzberg noch präsent: Kottbusser Tor, Hallesches Tor, Schlesisches Tor oder auch die Oberbaumbrücke. Nur ein einziges Tor ist erhalten geblieben und wurde zum Wahrzeichen der Stadt: das Brandenburger Tor.
//Karte
Mauerverlauf (aktueller Stand): Die Erforschung des genauen Mauerverlaufs ist Teil des Projekts, und soll vor allem in Zukunft weiter vorangetrieben werden. Der grobe Verlauf (Straßenzüge/Strukturen der Torgestaltungen) steht so gut wie fest.
Der exakte Verlauf vor dem Hintergrund der heutigen Bebauung (zb auf welcher Straßenseite einer heutigen Straße die Mauer verlief) ist aber oft noch unklar. Über Anmerkungen und Korrekturen zum tatsächlichen Mauerverlauf freuen wir uns sehr.
Der Verlauf der der Mauer kann neben der aktuellen Karte auch auf historischen Karten aus unterschiedlichen Zeiten angeguckt werden. Rechts oben auf der interaktiven Karte können als Hintergründe die Karten von 1750, 1804 und 1863 angeklickt werden.
Weil die Karten aber nicht ganz mit den Maßen der heutigen Karten übereinstimmen, gibt es hier leichte Verschiebungen, so dass der Verlauf zwar nicht immer ganz stimmt, aber im Kontext mit der Umgebungsbebauung nachvollziehbar bleibt.
//Stationen
Anhand von fünf Toren und anderen Durchfahrten durch die Mauer sollen die Grundzüge der historischen und topografischen Entwicklung sowie der Praxis an der Mauer erläutert werden
Verwirrung um alte Namen und neue Orte
Der Verlauf der Akzisemauer ist heute nur noch mit Mühe nachvollziehbar. Dass sie überhaupt noch im Gedächtnis ist, wenn auch nur ein paar Wenigen, liegt an den nach ihr benannten Straßen und Bahnhöfen, die auf dem ehemaligen Mauerverlauf liegen.
Eine Ausnahme bildet dabei das Frankfurter Tor. Der Kreuzungspunkt der U-Bahnlinie U3 und der Straßenbahnlinie M10, dessen Bild geprägt wird von den beiden hohen Türmen der Frankfurter Allee, liegt de facto nicht auf dem Verlauf der Akzisemauer.
Das heutige Frankfurter Tor stimmt nicht mit der Lage des historischen gleichnamigen Tores in der Akzisemauer überein. Im Zuge des Baus der Stalinallee bekam die vorher namenlose Kreuzung erst 1957 den Namen Frankfurter Tor. Das ursprüngliche Tor lag ca. 400 m weiter westlich auf der Karl-Marx-Allee, auf Höhe der Weberwiese.
Der Verlauf des alten Frankfurter Tores und seine genaue Lage sind schwierig nachzuvollziehen, denn es ist der einzige Ort auf der ehemaligen Mauerroute, an dem der Verlauf überbaut wurde. Die Blocks 8 Nord und Süd (Karl-Marx-Allee 90-103) liegen auf der Stelle, auf der die Mauer die Straße kreuzte – ungefähr auf Höhe des Computerspielemuseums. Sie verlief von der Marchlewskistraße kommend weiter im Weidenweg und dann auf dem Mittelstreifen der Friedensstraße, Richtung Volkspark Friedrichshain.
Das lange lange Nichts und die Reservierung für die Bahn
Ein „Eisenbahntor“ gab es zwar unter diesem Namen nicht. Aber mit dem Bau der Eisenbahn – die nur an diesem leeren Ort entstehen konnte – musste hier als Kontrollpunkt eine Durchfahrt geschaffen werden, die nur für die Züge nutzbar war.
Der Mauerabschnitt vom Frankfurter Tor zum Stralauer Tor war mit knapp zwei Kilometern weitaus die längste Strecke zwischen zwei Toren der Akzisemauer. Dieser heute so szenige Ort war damals ein ganz unwichtiger und menschenleerer Teil von Berlin und geprägt durch Sumpf und grüne Wiesen. Diese Bedeutungsarmut spiegelte sich auch in der Namensgebung wider: Die heutige Marchlewskistraße, die zwischenzeitlich, bis 1953, “Memeler Straße” hieß, hatte lange den unscheinbaren und holprigen Namen „Zwischen Frankfurter Tor und Stralauer Tor“.
In keinem Abschnitt war die Bebauungsdichte bis zum Abriss der Mauer so niedrig. Symptomatisch dafür ist der Umstand, dass es an dieser Stelle nur eine Begleitstraße an der Mauer gab, die sogenannte “innere Communication”, während in allen anderen Abschnitten der Mauer dieser Begleitweg auf beiden Seiten bestand. Hier im Zwischenreich aber war auf der einen Seite Wiese und auf der anderen Sumpf.
Diese große Leere war allerdings wegbereitend für die spätere Bebauung, die den Bezirk bis heute prägt. Auf diesen einsamen Wiesen wurde in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts der einzige Bahnhofskomplex innerhalb der Stadtmauern errichtet, denn hier war Platz. Damit entstand auch eine zusätzliche Passierstelle ohne offizielles Tor, die Durchfahrt für die Züge, die erstmals 1842 in den Stadtplänen zu finden ist. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Warschauer Brücke noch nicht. Sie wurde erst 1872 errichtet, als die Vielzahl an Schienen eine Brücke unumgänglich machte.
Die Bahnhöfe haben Friedrichshain geprägt – nicht nur die Entwicklung des wilden Vergnügungsviertels um den ehemaligen Ostbahnhof in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern auch die Mitte der 1990er Jahre entstandene Clublandschaft, die vielfach alte Industriegebäude genutzt hat bzw. immer noch nutzt.
Die vielen Waren auf den Schiffen
Die Akzisemauer hatte drei Tore im Wasser, die vor allem für den Schiffsverkehr genutzt wurden. Zwei lagen in Friedrichshain-Kreuzberg: der Oberbaum (mitsamt der Brücke) und das erst um 1850 gebaute Wassertor am heutigen Wassertorplatz, das die Verbindung des neu entstandenen, heute wieder zugeschütteten Luisenstädtischen Kanals mit dem Landwehrkanal bildete.
An diesen Wassertoren bzw. Wassergrenzen wurden die Schiffe aufgehalten, kontrolliert und zur Kasse gebeten, wenn sie mit vielen Waren den Weg zu den Verkaufsplätzen der Stadt suchten. Am Oberbaum geschah dies durch einen großen Baumstamm, eine hölzerne Barriere, die nachts ins Wasser gelassen wurde, um illegal passierende Schiffe an der Einfahrt zu hindern. Daher auch der Name “Oberbaum”, die Grenze am Oberlauf der Spree. Das Pendant im Nordwesten am Unterlauf der Spree war der “Unterbaum” zwischen Hauptbahnhof und Charité. Die eigentliche „Unterbaumbrücke“ heißt heute Kronprinzenbrücke.
Besonders interessant sind die riesigen Wasserbecken und Speicherplätze für Waren, die diesen Wassergrenzen vorgelagert sind: an der Spree der ehemalige Osthafen mit den großen Speichern und am Landwehrkanal das große Becken vis-à-vis zum Urban-Krankenhaus. Hier mussten die Schiffe mit den großen Mengen an Waren, die in die Stadt geliefert wurden, auf ihre Abfertigung warten.
Davor und dahinter – Migration und wilde Siedlungen vor der Mauer
Das Cottbusser Tor ist eines der ältesten Tore in der Akzisemauer. Wie auch bei den anderen Toren war hier eine wichtige Funktion nicht nur die Kontrolle des Warenverkehrs, sondern auch die Regulierung der Zugänge in die Stadt, also auch die Kontrolle von Menschen, die sich dauerhaft in Berlin ansiedeln wollten. Gleichzeitig wollte man so Straftaten vermeiden bzw. verfolgen und Krankheiten eindämmen. Insofern war die Mauer bzw. das jeweilige Tor für manche Personen, die aus der Stadt heraus, meist aber in die Stadt hinein wollten, auch der Endpunkt. Sie mussten sich vielfach ein anderes Tor suchen – so etwa die Juden, die ausschließlich das Rosenthaler Tor nutzen durften. Andere mussten umkehren oder einfach warten. Für manche wurde dieses Warten zu einem Dauerzustand; sie siedelten sich notgedrungen vor den Mauern der Stadt an. In den meisten Fällen hieß das, dass sie zwar kurzzeitig Zutritt zur Stadt bekamen, ihnen aber die Ansiedlung in der Stadt nicht genehmigt wurde. So wurde die Mauer auch zur sozialen Grenze. In der Spätphase der Mauer und vor allem in der Zeit ihres Abrisses in den 1860er und 70er Jahren entstanden gerade vor dem Cottbusser Tor die sogenannten Barrakia – wilde Siedlungen von Menschen, die innerhalb der Stadtmauern kein Zuhause oder keine Bleibe fanden, weil Besiedlungsdichte und Mieten innerhalb der Stadt so sprunghaft anstiegen.
Anders als vor den Toren im Norden der Stadt, wo die Mauer noch viel stärker soziale Grenze und Barriere war und die Menschen in unbeschreiblicher Armut lebten, gab es in den wilden Siedlungen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor dem Cottbusser Tor entstanden, einen gewissen Stolz der Bewohner*innen, die hier 1872 den „Freistaat Barrackia“ ausriefen. Die Siedlung wurde aber noch im selben Jahr unter massiven Protesten geräumt.
Prunk und Pracht für die Truppen
Das Hallesche Tor war das einzige Prunktor des Friedrichshain-Kreuzberger Abschnitts. Die übrigen Tore waren karg und schmucklos, anders als in den Abschnitten im heutigen Bezirk Mitte. Dort waren sie oft deutlich prächtiger. Das berühmteste Beispiel für ein Schmucktor ist das Brandenburger Tor.
Wozu all die Pracht? Der Repräsentationscharakter dieses glanzvollen Ein- und Ausgangs zur Stadt hängt unmittelbar zusammen mit seiner militärischen Bedeutung: Durch das Hallesche Tor marschierte die Armee aus der Stadt hinaus zum Tempelhofer Feld, das bis ins 20. Jahrhundert hinein wichtiger militärischer Übungsplatz war.
Bereits zu Bauzeiten der Mauer im Jahr 1738 war der heutige Franz-Mehring-Platz, damals “Belle Alliance Platz”, ein prunkvolles Rondell am südlichen Ende der Friedrichsvorstadt. Das Hallesche Tor wurde immer mehr zu einem Fixpunkt der militärischen Einrichtungen. In deren Nachbarschaft wurden bis ins späte 19. Jahrhundert hinein zahlreiche Kasernen und militärische Einrichtungen angesiedelt – so zum Beispiel die Kaserne des 1. und 2. Garde-Dragoner-Regiments auf dem heutigen Dragoner-Areal, das damals noch außerhalb der Mauer lag.
Die militärische Bedeutung der Akzisemauer bestand insgesamt nur zu einem geringen Anteil darin, ein Verteidigungsbollwerk zu sein. Vielmehr war sie eine Gefängnismauer für die oft brutal in die Armee gezwungenen und häufig privat in der Stadt untergebrachten preußischen Soldaten, die daran gehindert werden sollten, dem Dienst in der Armee zu entkommen.
//Geschichte
Berlin hat ein besonderes Verhältnis zu Mauern, speziell zu ihren Hinterlassenschaften und den Lücken, die sie gelassen haben. Im Bewusstsein ist vor allem die Berliner Mauer, die bis 1989 auch unseren Doppelbezirk in zwei Teile geteilt hat. Aber es gibt noch mindestens drei andere: die mittelalterliche Stadtmauer, deren Erweiterung zur Festung im 17. Jahrhundert und dann die sogenannte Zoll- und Akzisemauer. Mehr als die Hälfte ihrer knapp 15 Kilometer verlief durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Sie wurde 1734 bis 1737 errichtet und ersetzte die alte überflüssig gewordene Festung. Vor allem im Osten wurde mit ihr die befestigte Stadtgrenze deutlich weiter nach außen verschoben, von der Jannowitzbrücke zur Oberbaumbrücke. Sie war hauptsächlich dazu da, den Zustrom von Waren in die Stadt zu kontrollieren, um Zölle erheben zu können. Daher auch Ihr Name: Akzise war die städtische Zollsteuer. Und es gab einen zweiten Grund: Ihr Erbauer König Friedrich Wilhelm I. hatte bekanntermaßen einen ausgemachten Soldatenfetisch und wollte mit dem drei bis vier Meter hohen Bauwerk das Desertieren der mühsam im ganzen Land zusammengepressten Soldaten verhindern.
Der Verlauf der Mauer lässt sich nur noch topografisch und durch die Benennung von Straßen und Plätzen nachvollziehen. Während Straßen wie die „Oberwallstraße“ oder „Am Festungsgraben“ auf die alte Festung hinweisen, erinnern an die Akzisemauer weniger die Straßen (mal abgesehen von den Straßenverläufen), sondern die Namen der Tore, die in bis heute Stadtplätze benennen.
Interessant ist, dass die Akzisemauer außerhalb von Friedrichshain-Kreuzberg in den meisten Fällen an den heutigen Bezirksgrenzen verlief, beispielsweise am Brandenburger Tor zwischen Mitte und Tiergarten oder an einem Teil der Torstraße zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Nur in Friedrichshain und Kreuzberg lief sie mitten durch die späteren beiden Bezirke. Das liegt daran, dass diese Bezirke erst 1920 entstanden sind, mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Ende der Akzisemauer und nachdem die Stadt über sie hinaus gewachsen war.
In Kreuzberg ist der Verlauf einfach nachzuvollziehen: Von der Oberbaumbrücke, beziehungsweise dem Schlesischen Tor entlang der U-Bahn bis zum Halleschen Tor, dann rechts die Stresemannstraße entlang bis zum Potsdamer Platz. Vier von sechs Toren sind zumindest noch namentlich vorhanden: Schlesisches und Kottbusser Tor, das Wassertor am ehemaligen Luisenstädtischen Kanal, nach dem der Wassertorplatz benannt ist sowie das Hallesche Tor. Namentlich nicht mehr vorhanden sind das Köpenicker Tor am heutigen Lausitzer Platz und das Anhalter Tor am ehemaligen Anhalter Bahnhof.
Es gibt heute noch genau zwei kleine, etwa 20 m lange Reste dieser Mauer an der Stresemannstraße in Kreuzberg und an der Charité, dort sehr unscheinbar in einem kurzen Abschnitt der Hannoverischen Straße in eine Hauswand integriert.
In Friedrichshain ist es komplizierter. Da verläuft die Mauer versteckter, von der Oberbaumbrücke zum Stralauer Tor, passend zur heutigen Stralauer Allee, bis zur heutigen Warschauer Brücke, dann direkt am Balkon des Autors vorbei durch die Marchlewskistraße bis zum damaligen Frankfurter Tor. Eine Strecke von etwa zwei Kilometern. Verglichen mit dem Durchschnittsabstand von 460 Metern zwischen zwei Toren in Kreuzberg, ist das ein langer Weg.
Es muss ein beschauliches Leben hinter der Mauer gewesen sein. Das Frankfurter Tor lag damals weiter westlich, ein Stück hinter der Kreuzung Frankfurter Allee / Straße der Pariser Kommune, wo heute der U-Bahnhof Weberwiese ist. Der Weg der Akzisemauer setzte sich ähnlich unspektakulär fort: Durch die Friedenstraße zum nächsten und letzten Friedrichshainer Tor, dem Landsberger Tor an der Landsberger Allee vor dem Volkspark Friedrichshain. Das nächste lag dann am Ende des Volksparkes schon im heutigen Prenzlauer Berg: das Königstor an der Greifswalder Straße.
In Friedrichshain hatte die Mauer den deutlichen Charakter einer Grenze im Grünen, weniger den einer Stadtmauer, war auch mit wenig Personal besetzt und, wie schon vermerkt, mit nur drei Toren ausgestattet.
Mit dem Stadtwachstum im 19. Jahrhundert rückte die Stadt mit immer höherer Bebauungsdichte an die Mauer heran und überwand sie schließlich.
Dass Mauern nach ihrer Existenz noch eine deutliche Wirkung auf die Stadt haben können, trifft auch auf die Akzisemauer zu, wenn auch kaum erkennbar. Eine Grenze markiert der Verlauf der ehemaligen Akzisemauer in Friedrichshain auch noch heute (zumindest fast), nämlich die Grenze zwischen dem Szenekiez Friedrichshain in den Altbauten im Süd- und Nordkiez und vorwiegend in den Neubauten zwischen den 1950er und 1970er Jahre in Friedrichshain-West. Vielleicht bietet es sich an, solche Grenzen auch produktiv zu nutzen, indem man sie hier und da überwindet, um auch mal in den anderen Teil Friedrichshains hinüberzugucken. Zudem wäre es toll, wenn in Zukunft der Verlauf dieser Mauer – die immerhin 150 Jahre den Doppelbezirk durchschnitten hat – besser sichtbar und nachvollziehbar wäre.
Artikel zuerst erschienen im Friedrichshainer Zeitzeiger (12/18)
//Projekt
Mit dem Akzisemauerprojekt wollen wir die weitgehend in Vergessenheit geratene Akzisemauer wieder ins Bewusstsein rufen – in einem Mix aus Forschung, Ideenentwicklung und temporärer künstlerisch-historischer Präsentation im öffentlichen Raum. Gemeinsam mit einer Runde aus Historiker*innen wurden zunächst Fakten zur Akzisemauer gesammelt und daraus Ideen entwickelt, wie sie in Zukunft im Bezirk und darüber hinaus künstlerisch präsentiert werden kann.
Im Rahmen des Projekts werden an fünf Orten entlang des Verlaufs der früheren Mauer in Friedrichshain-Kreuzberg Plakate und Aufkleber angebracht. Diese Präsentation der Mauer im Stadtraum von heute und ihre Wirkung auf die Nachbarschaft ist dokumentiert worden. Darauf aufbauend wird es eine Ausstellung im Frühjahr 2021 im FHXB Museum geben.
Das Projekt und vor allem die Website wird inhaltlich und gestalterisch mitbetreut von Alexander Städler.
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Bezirkskulturfonds.